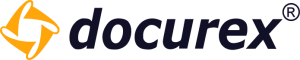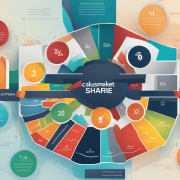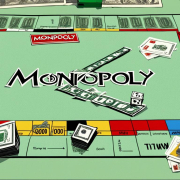Was ist ein Oligopol? – Ihr Wirtschaftsleitfaden
Ein Oligopol ist eine Marktform, bei der wenige Anbieter vielen, relativ kleinen Nachfragern gegenüberstehen. Es handelt sich um eine häufig anzutreffende Marktstruktur in verschiedenen Branchen wie der Automobilherstellung, der Mineralölindustrie und der Computerindustrie. Oligopole entstehen durch den Konzentrationsprozess in der Wirtschaft und decken in manchen Bereichen den kompletten Bedarf an Gütern ab. Es gibt verschiedene Formen von Oligopolen, sowohl auf vollkommenen Märkten (wie dem Mineralölmarkt) als auch auf unvollkommenen Märkten (wie dem Waschmittelmarkt). Typisch für ein Oligopol ist die hohe Marktanteilskonzentration bei wenigen Anbietern, die bei der Preisfestsetzung, der Produktion und der Qualität ihrer Güter sowohl die Reaktion der Nachfrager als auch die Reaktion ihrer Konkurrenten berücksichtigen müssen.
Schlüsselerkenntnisse:
- Ein Oligopol ist eine Marktform mit wenigen Anbietern und vielen Nachfragern.
- Oligopole treten in verschiedenen Branchen auf, wie der Automobilherstellung und der Mineralölindustrie.
- In einem Oligopol müssen Anbieter sowohl die Reaktion der Nachfrager als auch die Reaktion ihrer Konkurrenten berücksichtigen.
- Es gibt verschiedene Arten von Oligopolen, sowohl auf vollkommenen als auch auf unvollkommenen Märkten.
- Oligopole können zu intensivem Wettbewerb und Preiskampf führen, aber auch zu kartellrechtlich verbotenen Absprachen.
Merkmale eines Oligopols
In einem Oligopol dominieren wenige große Anbieter den Markt und besitzen einen bedeutenden Marktanteil. Diese Unternehmen decken den Bedarf in einem bestimmten Wirtschaftsbereich weitgehend ab. Bei der Festlegung von Preisen, Produktionsmengen und Güterqualitäten müssen Oligopolisten nicht nur die Reaktionen der Nachfrager, sondern auch die Reaktionen ihrer Konkurrenten berücksichtigen. Maßnahmen wie Preisänderungen oder die Einführung neuer Produkte führen zu Reaktionen der anderen Anbieter und können zu einem scharfen Wettbewerb und Preiskampf führen. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass die wenigen großen Anbieter ihr Marktverhalten untereinander abstimmen, um einen Verdrängungswettbewerb zu verhindern. Jedoch sind derartige Absprachen kartellrechtlich verboten.
Arten von Oligopolen
Es gibt verschiedene Arten von Oligopolen, darunter das Angebotsoligopol und das Nachfrageoligopol.
Beim Angebotsoligopol gibt es viele Nachfrager und nur wenige Anbieter. Ein Beispiel hierfür ist die deutsche Automobilindustrie, in der große Autohersteller wie Volkswagen, BMW und Daimler den Markt dominieren.
Beim Nachfrageoligopol gibt es hingegen nur wenige Nachfrager und viele Anbieter. Ein Beispiel ist die Landwirtschaft, in der viele Landwirte ein Gut wie Getreide produzieren und es an wenige Mühlen verkaufen.
| Angebotsoligopol | Nachfrageoligopol |
|---|---|
| Viele Nachfrager und wenige Anbieter | Wenige Nachfrager und viele Anbieter |
| Beispiel: Deutsche Automobilindustrie mit Volkswagen, BMW und Daimler | Beispiel: Landwirtschaft mit vielen Landwirten und wenigen Mühlen |
Oligopol Beispiel
Es gibt zahlreiche Beispiele für Oligopole in verschiedenen Branchen. Ein bekanntes Beispiel ist der Mobilfunkmarkt, auf dem drei große Netzwerkbetreiber den Markt beherrschen: T-Mobile, Vodafone und Telefónica Germany. Sie teilen sich den Großteil der Kunden und decken den Bedarf an Mobilfunkdiensten in Deutschland ab.
Ein weiteres Beispiel für ein Oligopol ist die europäische Mineralölgesellschaft, bei der große Unternehmen wie BP/Aral, Esso, Jet, Shell und Total den Markt dominieren. Sie kontrollieren einen beträchtlichen Anteil des Benzin- und Dieselmarktes und haben einen erheblichen Einfluss auf die Preise und Verfügbarkeit von Treibstoffen.
Auch die Flugzeugindustrie kann als Beispiel für ein Oligopol genannt werden. Hier dominieren Airbus und Boeing den Markt für Verkehrsflugzeuge. Diese beiden Unternehmen sind die Hauptakteure in der Entwicklung und Produktion von Passagierflugzeugen und haben eine hohe Marktmacht.
In der deutschen Automobilindustrie gibt es ebenfalls ein Oligopol mit großen Autoherstellern wie Volkswagen, BMW und Daimler. Diese Unternehmen kontrollieren den Großteil des deutschen Automobilmarktes und beeinflussen maßgeblich die Preise, die Produktentwicklung und den Wettbewerb in der Branche.
Diese Beispiele verdeutlichen, wie Oligopole in verschiedenen Branchen auftreten können und wie wenige große Unternehmen den Markt beherrschen. Sie haben erheblichen Einfluss auf Preise, Qualität und Innovation in ihren jeweiligen Märkten.
Um den Text ein wenig aufzulockern, könnten wir eine Tabelle mit den genannten Beispielen erstellen, um die wichtigsten Informationen übersichtlich darzustellen. Hier ist ein Vorschlag für die Tabelle:
| Branchen | Beispiele |
|---|---|
| Mobilfunk | T-Mobile, Vodafone, Telefónica Germany |
| Mineralöl | BP/Aral, Esso, Jet, Shell, Total |
| Flugzeugindustrie | Airbus, Boeing |
| Automobilindustrie | Volkswagen, BMW, Daimler |
Diese Tabelle gibt einen Überblick über die verschiedenen Branchen und die Oligopolunternehmen, die in diesen Bereichen dominieren. Sie veranschaulicht die Vielfalt der Oligopole und ihre Auswirkungen auf den jeweiligen Markt.
Bilaterales (zweiseitiges) Oligopol
Ein bilaterales Oligopol, auch zweiseitiges Oligopol genannt, liegt vor, wenn wenige Anbieter wenigen Nachfragern gegenüberstehen. Ein Beispiel hierfür sind wenige Anbieter von großen Kreuzfahrtschiffen, die auf wenige Reedereien als Nachfrager treffen. In einem bilateralen Oligopol müssen sowohl die Anbieter als auch die Nachfrager die Reaktionen der jeweils anderen Seite berücksichtigen.
Reaktionsverbundenheit und Wettbewerb in Oligopolen
In einem Oligopol besteht eine starke Verbindung zwischen den Anbietern, da jede Aktion eines Oligopolisten eine Reaktion der Konkurrenten zur Folge hat. Dadurch entsteht ein intensiver Wettbewerb zwischen den Oligopolisten. Wenn ein Anbieter beispielsweise seinen Preis senkt, werden die Konkurrenten oft schnell reagieren, um keine Kunden zu verlieren. Diese ständige Konkurrenz unter den Oligopolisten kann jedoch auch zu kartellähnlichen Absprachen führen, bei denen die Anbieter ihr Marktverhalten untereinander abstimmen. Solche Absprachen sind jedoch gesetzlich verboten.
| Oligopolverhalten | Folgen für den Wettbewerb |
|---|---|
| Preissenkungen | Konkurrenten reagieren oft mit Preissenkungen, um Kunden zu halten |
| Produktinnovationen | Konkurrenten entwickeln ebenfalls neue Produkte, um wettbewerbsfähig zu bleiben |
| Werbeaktionen | Konkurrenten reagieren mit eigenen Werbeaktionen, um Kunden abzuwerben |
Die Reaktionsverbundenheit und der Wettbewerb in Oligopolen haben Auswirkungen auf den Markt. Kunden können von niedrigeren Preisen und innovativen Produkten profitieren, da Unternehmen bestrebt sind, ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Andererseits besteht jedoch die Gefahr von kartellartigen Praktiken, die den Wettbewerb einschränken und den Verbrauchern schaden. Aus diesem Grund gibt es gesetzliche Bestimmungen, die solche Absprachen verbieten und den fairen Wettbewerb fördern sollen.
Beispiel aus der Automobilindustrie
Ein anschauliches Beispiel für die Reaktionsverbundenheit und den Wettbewerb in einem Oligopol ist die Automobilindustrie. Große Automobilhersteller wie Volkswagen, BMW und Daimler konkurrieren miteinander um Marktanteile und Kunden. Wenn einer dieser Hersteller beispielsweise ein neues Modell mit innovativen Funktionen auf den Markt bringt, werden die anderen Hersteller ebenfalls bestrebt sein, vergleichbare Modelle anzubieten. Preisänderungen, Produktinnovationen und Marketingstrategien sind nur einige der Bereiche, in denen der Wettbewerb zwischen den Oligopolisten stattfindet.
Die Reaktionsverbundenheit in Oligopolen kann sowohl zu einem intensiven Wettbewerb als auch zu kartellartigen Absprachen führen. Die Auswirkungen auf den Markt und die Verbraucher hängen von der Art des Oligopols und dem Verhalten der beteiligten Unternehmen ab. Es ist daher wichtig, dass kartellrechtliche Vorschriften durchgesetzt werden, um den fairen Wettbewerb zu gewährleisten und die Verbraucher zu schützen.
Marktformen innerhalb des Oligopols
Innerhalb des Oligopols gibt es verschiedene Marktformen, die sich voneinander unterscheiden. Dabei sind das homogene Oligopol und das heterogene Oligopol zwei wichtige Konzepte, um die Vielfalt der Marktstrukturen in einem Oligopol zu verstehen.
Homogenes Oligopol
Im homogenen Oligopol sind die angebotenen Güter absolut gleichwertig aus Sicht der Nachfrager. Das bedeutet, dass die Produkte der verschiedenen Anbieter kaum Unterschiede aufweisen und in den Augen der Kunden als perfekte Substitute betrachtet werden können. Ein Beispiel für ein homogenes Oligopol ist der Markt für Rohöl, auf dem die gehandelten Güter weitgehend gleichartig sind. Die Ölproduzenten haben kaum Möglichkeiten, sich durch besondere Produktmerkmale von ihren Konkurrenten abzuheben. Stattdessen konkurrieren sie vor allem über den Preis und die Menge an Rohöl, die sie auf den Markt bringen.
Heterogenes Oligopol
Im heterogenen Oligopol hingegen sind die Güter keine perfekten Substitute und können sich nur teilweise ersetzen. Hier bieten die verschiedenen Anbieter Produkte an, die sich in ihren Eigenschaften, Funktionen oder Qualitäten unterscheiden. Dadurch entstehen differenzierte Marktsegmente, in denen die Anbieter verschiedene Zielgruppen ansprechen können. Ein Beispiel für ein heterogenes Oligopol ist der Markt für Smartphones, auf dem Unternehmen wie Apple, Samsung und Huawei konkurrieren. Jeder Anbieter hat seine eigene Markenidentität, Designmerkmale und Software, die seine Produkte von den Konkurrenzprodukten unterscheiden.
Die Unterscheidung zwischen homogenem und heterogenem Oligopol ist wichtig, um die verschiedenen Wettbewerbsstrategien und -taktiken der Oligopolisten zu verstehen. Im homogenen Oligopol steht der Preiswettbewerb im Vordergrund, während im heterogenen Oligopol die differenzierte Produktgestaltung und Markenidentität eine wichtige Rolle spielen.
| Vergleich von homogenem und heterogenem Oligopol | Homogenes Oligopol | Heterogenes Oligopol |
|---|---|---|
| Angebote | Produkte sind absolut gleichwertig und als perfekte Substitute zu betrachten | Produkte weisen Unterschiede in Eigenschaften, Funktionen oder Qualitäten auf |
| Wettbewerb | Preiswettbewerb steht im Vordergrund | Differenzierte Produktgestaltung und Markenidentität sind wichtige Wettbewerbsfaktoren |
| Beispiel | Markt für Rohöl | Markt für Smartphones |
Die Unterscheidung zwischen homogenem und heterogenem Oligopol ermöglicht es uns, die verschiedenen Marktformen innerhalb des Oligopols besser zu verstehen und ihre Auswirkungen auf den Wettbewerb und die Marktstruktur zu analysieren.
Spieltheorie und Oligopolanalyse
Die Oligopolanalyse wird häufig mit den Instrumenten der Spieltheorie durchgeführt. Dabei können die einzelnen Anbieter antizipieren, wie ihre Konkurrenten reagieren werden. Ein Marktgleichgewicht, auch als Nash-Gleichgewicht bezeichnet, liegt dann vor, wenn kein Anbieter einen Anreiz hat, seine Preise oder Mengen zu verändern.
Die Spieltheorie ermöglicht es uns, die Interaktion zwischen den Oligopolisten zu analysieren und deren Entscheidungsprozesse besser zu verstehen. Die Oligopolisten betrachten ihre Konkurrenten als Spieler in einem Spiel, bei dem jeder Spieler versucht, seine eigene Auszahlung oder seinen eigenen Gewinn zu maximieren. Durch die Anwendung der Spieltheorie können wir die strategischen Entscheidungen der Oligopolisten vorhersagen und mögliche Marktgleichgewichte identifizieren.
Das Marktgleichgewicht im Oligopol wird häufig als Nash-Gleichgewicht bezeichnet, benannt nach dem Mathematiker John Nash, der dieses Konzept entwickelt hat. In einem Nash-Gleichgewicht führt keine der beteiligten Parteien eine Änderung herbei, da sie alle ihre beste Antwort auf das Verhalten der anderen Parteien gefunden haben. Das bedeutet, dass kein Oligopolist einen Anreiz hat, seine Preise oder Mengen zu verändern, da dies zu einer ungünstigen Reaktion der Konkurrenten führen würde.
Durch die Analyse mit Hilfe der Spieltheorie können wir also das Marktgleichgewicht im Oligopol bestimmen und verstehen, wie die Marktteilnehmer auf Veränderungen in Preisen, Mengen oder anderen Faktoren reagieren werden. Dies ist von großer Bedeutung für Unternehmen, die in einem Oligopol tätig sind, da sie ihre strategischen Entscheidungen optimal treffen müssen, um im Wettbewerb zu bestehen.
Rechtliche Konsequenzen von Oligopolen
Direkte Preisabsprachen und Fusionen zwischen Unternehmen in einem Oligopol können rechtliche Konsequenzen haben. Preisabsprachen sind kartellrechtlich verboten und Fusionen können vom Kartellamt untersagt werden, wenn sie zu einem schädlichen Oligopol führen. Ein schädliches Oligopol liegt vor, wenn eine Kollusion der Oligopolisten droht oder wenn die Imitation der Oligopolisten zu einem Oligopolfrieden führt.
Für Unternehmen in einem Oligopol ist es daher von größter Bedeutung, das Kartellverbot zu beachten und wettbewerbskonform zu handeln. Preisabsprachen können zu empfindlichen Geldstrafen und Reputationsschäden führen. Fusionen zwischen Oligopolisten werden vom Kartellamt genau unter die Lupe genommen, um sicherzustellen, dass sie den Wettbewerb nicht einschränken.
| Rechtliche Konsequenzen von Oligopolen | Beschreibung |
|---|---|
| Kartellverbot | Preisabsprachen sind kartellrechtlich verboten und werden mit Geldstrafen geahndet. |
| Untersagung von Fusionen | Fusionen zwischen Oligopolisten können vom Kartellamt untersagt werden, wenn sie zu einem schädlichen Oligopol führen. |
| Oligopolfrieden | Wenn die Imitation der Oligopolisten zu einem Oligopolfrieden führt, können rechtliche Schritte ergriffen werden. |
Es ist wichtig, dass Unternehmen in einem Oligopol sich der rechtlichen Konsequenzen bewusst sind und sich an die geltenden Gesetze halten. Eine regelmäßige Überprüfung der eigenen Geschäftspraktiken und eine enge Zusammenarbeit mit Rechtsberatern können helfen, rechtliche Risiken zu minimieren und einen fairen und transparenten Wettbewerb sicherzustellen.
Das Kartellrecht in Deutschland
In Deutschland wird das Kartellrecht durch das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) geregelt. Das Kartellamt ist die zuständige Behörde für die Durchsetzung des Kartellrechts. Es überwacht den Wettbewerb auf dem deutschen Markt und greift bei Verstößen gegen das Kartellverbot ein. Das Kartellamt kann Geldbußen verhängen und Fusionen zwischen Unternehmen untersagen, wenn sie den Wettbewerb einschränken.
Das Kartellrecht spielt eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs und des Schutzes der Verbraucher. Es soll sicherstellen, dass Unternehmen unabhängig und ohne wettbewerbswidrige Praktiken agieren können. Indem sie das Kartellverbot respektieren, leisten Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung eines gesunden und transparenten Marktumfelds.
Beispiele für Oligopole
Es gibt viele Beispiele für Oligopole in verschiedenen Branchen. Ein Beispiel ist die deutsche konventionelle Stromerzeugung, bei der die fünf Großkonzerne Uniper, RWE, EnBW, LEAG und Vattenfall etwa 70% des nicht durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz vergüteten Stroms erzeugen.
Ein weiteres Beispiel ist der Fahrtreppenbau, bei dem es nur fünf große Hersteller gibt. Auch der Mobilfunkmarkt mit drei Netzwerkbetreibern und die Mineralölwirtschaft mit den „Großen Fünf“ (BP/Aral, Esso, Jet, Shell, Total) sind Beispiele für Oligopole.
Beispiel für Oligopol in der deutschen konventionellen Stromerzeugung
In der deutschen konventionellen Stromerzeugung dominieren fünf Großkonzerne den Markt. Uniper, RWE, EnBW, LEAG und Vattenfall erzeugen zusammen etwa 70% des nicht durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz vergüteten Stroms.
| Großkonzern | Marktanteil |
|---|---|
| Uniper | 20% |
| RWE | 20% |
| EnBW | 15% |
| LEAG | 10% |
| Vattenfall | 5% |
Beispiel für Oligopol im Fahrtreppenbau
Im Fahrtreppenbau gibt es nur fünf große Hersteller, die den Markt dominieren. Sie sind verantwortlich für die Produktion und Installation von Fahrtreppen in vielen Städten auf der ganzen Welt.
Beispiel für Oligopol im Mobilfunkmarkt
Der Mobilfunkmarkt in Deutschland wird von drei großen Netzwerkbetreibern dominiert: T-Mobile, Vodafone und Telefónica Germany. Diese Anbieter kontrollieren den Großteil des Marktes und bieten Mobiltelefonie- und Datendienste für Millionen von Kunden an.
| Netzwerkbetreiber |
|---|
| T-Mobile |
| Vodafone |
| Telefónica Germany |
Beispiel für Oligopol in der Mineralölwirtschaft
Die Mineralölwirtschaft wird von den sogenannten „Großen Fünf“ dominiert: BP/Aral, Esso, Jet, Shell und Total. Diese Unternehmen haben einen erheblichen Marktanteil und spielen eine wichtige Rolle beim Vertrieb von Erdölprodukten wie Benzin und Diesel.
| Mineralölgesellschaft |
|---|
| BP/Aral |
| Esso |
| Jet |
| Shell |
| Total |
Fazit
Fazit Oligopol: Ein Oligopol ist eine Marktform, bei der wenige Anbieter vielen Nachfragern gegenüberstehen. Diese wenigen großen Anbieter haben die Marktmacht und müssen ihre Preise und Produktionsmengen an die Reaktionen der Nachfrager und Konkurrenten anpassen. Oligopole können zu intensivem Wettbewerb und Preiskampf führen, aber auch zu kartellrechtlich verbotenen Absprachen zwischen den Anbietern. Es gibt verschiedene Arten von Oligopolen wie das Angebotsoligopol, das Nachfrageoligopol und das bilaterale Oligopol. Beispiele für Oligopole finden sich in Branchen wie der Automobilindustrie, der Mineralölindustrie und der Flugzeugindustrie. Die Analyse von Oligopolen erfolgt häufig mit den Instrumenten der Spieltheorie.
FAQ
Was ist ein Oligopol?
Ein Oligopol ist eine Marktform, bei der wenige Anbieter vielen, relativ kleinen Nachfragern gegenüberstehen. Es handelt sich um eine häufig anzutreffende Marktstruktur in verschiedenen Branchen wie der Automobilherstellung, der Mineralölindustrie und der Computerindustrie.
Was sind die Merkmale eines Oligopols?
Die Merkmale eines Oligopols sind, dass wenige große Anbieter den Markt beherrschen und einen großen Marktanteil besitzen. Diese Anbieter decken den Güterbedarf in einem bestimmten Wirtschaftsbereich komplett ab. Jeder Oligopolist muss bei der Festlegung von Preisen, Produktionsmengen und Güterqualitäten nicht nur die Reaktion der Nachfrager, sondern auch die Reaktion der Konkurrenten berücksichtigen.
Welche Arten von Oligopolen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Oligopolen, darunter das Angebotsoligopol und das Nachfrageoligopol. Beim Angebotsoligopol gibt es viele Nachfrager und nur wenige Anbieter, wie zum Beispiel in der deutschen Automobilindustrie. Beim Nachfrageoligopol gibt es hingegen nur wenige Nachfrager und viele Anbieter, wie zum Beispiel in der Landwirtschaft.
Was sind Beispiele für Oligopole?
Es gibt zahlreiche Beispiele für Oligopole in verschiedenen Branchen. Ein bekanntes Beispiel ist der Mobilfunkmarkt, auf dem drei große Netzwerkbetreiber den Markt beherrschen. Ein weiteres Beispiel ist die europäische Mineralölgesellschaft, bei der große Unternehmen den Markt dominieren. Auch die Flugzeugindustrie mit Airbus und Boeing kann als Beispiel für ein Oligopol genannt werden. In der deutschen Automobilindustrie gibt es ebenfalls ein Oligopol mit großen Autoherstellern.
Was ist ein bilaterales Oligopol?
Ein bilaterales Oligopol, auch zweiseitiges Oligopol genannt, liegt vor, wenn wenige Anbieter wenigen Nachfragern gegenüberstehen. Ein Beispiel hierfür sind wenige Anbieter von großen Kreuzfahrtschiffen, die auf wenige Reedereien als Nachfrager treffen.
Was ist Reaktionsverbundenheit und Wettbewerb in Oligopolen?
In einem Oligopol besteht eine Reaktionsverbundenheit zwischen den Anbietern, da jede Maßnahme eines Oligopolisten zu einer Reaktion der Konkurrenten führt. Dies kann zu einem intensiven Wettbewerb zwischen den Oligopolisten führen.
Welche Marktformen existieren innerhalb des Oligopols?
Im homogenen Oligopol sind die angebotenen Güter absolut gleichwertig aus Sicht der Nachfrager. Im heterogenen Oligopol sind die Güter hingegen keine perfekten Substitute und können sich nur teilweise ersetzen.
Wie wird die Oligopolanalyse durchgeführt?
Die Analyse von Oligopolen erfolgt häufig mit den Instrumenten der Spieltheorie, bei der die einzelnen Anbieter antizipieren, wie ihre Konkurrenten reagieren werden. Ein Marktgleichgewicht liegt dann vor, wenn kein Anbieter einen Anreiz hat, seine Preise oder Mengen zu verändern.
Welche rechtlichen Konsequenzen haben Oligopole?
Direkte Preisabsprachen sind kartellrechtlich verboten und Fusionen können vom Kartellamt untersagt werden, wenn sie zu einem schädlichen Oligopol führen. Ein schädliches Oligopol liegt vor, wenn eine Kollusion der Oligopolisten droht oder wenn die Imitation der Oligopolisten zu einem Oligopolfrieden führt.
Welche Beispiele gibt es für Oligopole?
Es gibt viele Beispiele für Oligopole in verschiedenen Branchen. Beispiele sind die deutsche konventionelle Stromerzeugung, der Fahrtreppenbau, der Mobilfunkmarkt und die Mineralölwirtschaft.
Was ist das Fazit zum Thema Oligopol?
Ein Oligopol ist eine Marktform, bei der wenige Anbieter vielen Nachfragern gegenüberstehen. Die Marktmacht liegt bei den wenigen großen Anbietern, die ihre Preise und Produktionsmengen an die Reaktionen der Nachfrager und ihrer Konkurrenten anpassen müssen.
Quellenverweise
- Über den Autor
- Aktuelle Beiträge
Katharina arbeitet und schreibt als Journalistin für die Redaktion von Text-Center.com und außerdem über wirtschaftliche Themen z.B. im Blog von Unternehmer-Portal.net .